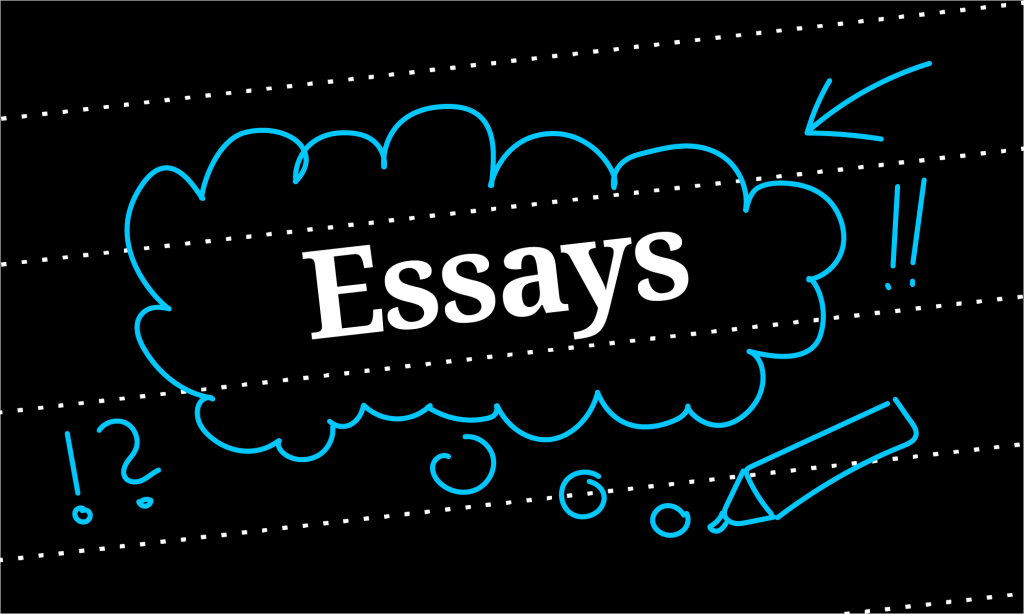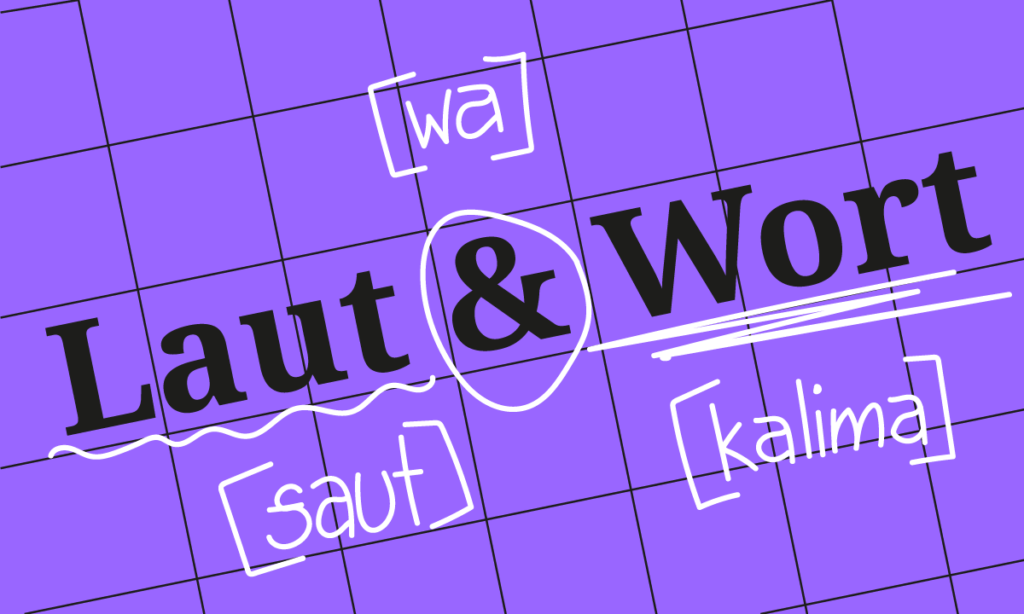Literarisches Übersetzen – Potentiale für die Kulturelle Bildung
Ein Essay von Juliane Schallau
In einem Interview mit dem Online-Magazin Words Without Borders beschrieb die US-amerikanische Übersetzerin Susan Bernofsky das literarische Übersetzen einmal als „the slowest possible reading“ – die langsamste Lektüre, die es gibt. Die Übertragung eines Textes in eine andere Sprache setze eine gründliche Untersuchung seines Aufbaus und seiner Wirkung voraus, ebenso wie eine Analyse der sprachlichen Mittel, die diese Wirkung erzielen. In diesem Sinne lässt sich die Praxis der Literaturübersetzung als rezeptiver Prozess verstehen, in dessen Verlauf die (offene) Bedeutung eines literarischen Werks wahrgenommen und verarbeitet wird. Dem US-amerikanischen Sprachwissenschaftler und Übersetzer Douglas Robinson zufolge ist das literarische Übersetzen aber zugleich auch eine Form des Schreibens. In seiner Monografie Who Translates? Translator Subjectivities Beyond Reason stellt er die These auf, der oder die Übersetzende wäre auch Autor·in, in dem Sinne, dass er oder sie ähnlich wie ein·e Autor·in schreiben und dabei auf eigene Sprach- und Welterfahrungen zurückgreifen würde. Dem literarischen Übersetzen kommt folglich eine Doppelrolle als zugleich rezeptive sowie produktive Arbeit zu: Die intensive Auseinandersetzung mit einem fremdsprachigen Text mündet in eine Neuerzählung des Originals. Aufgrund dieser Doppelrolle, so soll hier argumentiert werden, bietet die Praxis des literarischen Übersetzens großes Potential für die kulturelle Bildung, deren Hauptaufgabe laut Bundesministerium für Bildung und Forschung in der Befähigung von Kindern und Jugendlichen „zum schöpferischen Arbeiten und ebenso zur aktiven Rezeption von Kunst und Kultur“ liegt. Im Hinblick auf diese Formulierung steht dabei weniger das ‚Endprodukt‘ des literarischen Übersetzens, also der übersetzte Text selbst, im Fokus, sondern vielmehr der Prozess.
Die Vermittlung literarischen Übersetzens im Rahmen der kulturellen Bildung hat sich das Projekt echt absolut zum Ziel gesetzt. Dessen Initiatoren, das Literarische Colloquium Berlin und der Deutsche Übersetzerfonds, stellen fest: „Literarisches Übersetzen war in der kulturellen Bildung bisher unterrepräsentiert.“ Vermutlich hängt das mit den Vorurteilen zusammen, die sowohl dem Übersetzungsprozess als auch dem übersetzten Text anhaften. Übersetzungen werde oft die Originalität abgesprochen, wie Brian James Baer, Professor für Russisch und Übersetzungswissenschaften an der Kent State University in Ohio, feststellt. Zum einen tendierten Fremdsprachenabteilungen dazu, Übersetzungen als Ablenkung der Studierenden vom Original anzusehen. Zum anderen würden internationale Verlagshäuser Übersetzungen als exakte Entsprechungen des Originals vermarkten. Übersetzungen würden daher entweder außer Acht gelassen oder als notwendiges Übel betrachtet. Die Wahrnehmung und Wertschätzung der Arbeit von Übersetzer·innen werde wiederum stark beeinflusst von der vorherrschenden Vorstellung, das literarische Übersetzen wäre ein simples Zuordnungsspiel mit ausschließlich richtigen und falschen Lösungen – ein Umstand, der wahrscheinlich auf die Allgegenwart maschineller Übersetzung zurückzuführen ist. Baer befasst sich mit der Rolle der Übersetzung für den schulischen und universitären Literaturunterricht und plädiert für einen speziellen Lesemodus für übersetzte Texte, der diese nicht als Angleichung an die Normen und Erwartungen der Zielkultur, sondern als Erweiterung des Originals begreift.
Die auf außerschulische Maßnahmen fokussierte kulturelle Bildung vermag hier einen Schritt weiterzugehen. Anstatt sich der Interpretation des Originals anhand einer abgeschlossenen Übersetzung zu nähern, kann die Rezeption über die Produktion erfolgen. Kinder und Jugendliche erschließen den Text, indem sie ihn selbst übersetzen. Das eigentliche Potential des literarischen Übersetzens als Angebot kultureller Bildung geht jedoch auch über dieses erweiterte Textverständnis hinaus, da es Kindern und Jugendlichen die Chance zur Aneignung kultureller Ausdrucksformen bietet. Dies ist eines der Prinzipien der Kinder- und Jugendkulturarbeit, die von der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) aufgelistet werden. Demnach spiele neben der Wahrnehmung von und Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur das „Selbermachen“ eine zentrale Rolle in der Praxis kultureller Bildung. Den Prozess des literarischen Übersetzens beschreibt die deutsche Übersetzerin Gabriele Leupold in ihrem Artikel „Ketten und Spielraum. Entscheidungen beim Übersetzen“ sehr anschaulich:
Ich beginne mit der Übersetzung, stoße auf Probleme, versuche sie zu formulieren, habe Ideen zu ihrer Lösung. Dann stelle ich fest, daß sie nichts oder nur partiell taugen, und suche und spinne weiter. Manches ist Blödsinn, manches interessant, aber, wie ich spüre, noch nicht das Gesuchte. Immer wieder wird die Frage präzisiert, die Materialsammlung gesichtet, ergänzt, reduziert – und irgendwann ist das Ergebnis da, das sich argumentativ begründen läßt.
Um diesen Prozess zu vermitteln und Kinder und Jugendliche bei der Aneignung der kulturellen Ausdrucksform des literarischen Übersetzens zu unterstützen, stellt das Projekt echt absolut ihnen professionelle Literaturübersetzer·innen an die Seite. Dass die so entstehenden übersetzten Texte nicht, wie im Falle der Übersetzer·innen, dem Zweck der Veröffentlichung, sondern eher dem Selbstzweck dienen, ist dabei keineswegs eine Schwäche des literarischen Übersetzens als Praxis der kulturellen Bildung. Vielmehr entspricht es dem Bildungsstandard, den Mark Schrödter, Professor für Sozialpädagogik des Kindes- und Jugendalters an der Universität Kassel, für die Kinder- und Jugendarbeit fordert. In Bezug auf die Kulturarbeit fragt er:
Was ist denn wertvoll beim Erschaffen und Aneignen von Kultur? Ist die Ausübung dieser kulturellen Tätigkeiten nicht an sich wertvoll, in dem Sinne, als dass sie unser Menschsein erst verwirklicht – egal, was es an Nutzen bringt? Das ist eine wichtige Bildungsperspektive und immer in Gefahr, weil unsere kapitalistische Gesellschaft dazu tendiert, alles dem Paradigma der Produktion zu unterwerfen.
Diesem Bildungsanspruch wird das literarische Übersetzen als Angebot der kulturellen Bildung durch seine Prozesshaftigkeit gerecht: Kinder und Jugendliche werden nicht etwa zu Übersetzer·innen ausgebildet, sondern für die Tätigkeit des Übersetzens sensibilisiert. Das Ausüben derselben eröffnet die Möglichkeit, sich sowohl mit der eigenen als auch einer fremden Lebenswelt auseinanderzusetzen und Verbindungspunkte zwischen den beiden zu finden. Beim literarischen Übersetzen kommt zwangsläufig die Frage auf, was das Gesagte im Originaltext mit der eigenen Welt, dem eigenen Leben, zu tun hat. Auf der Suche nach der passenden Formulierung, dem passenden Ausdruck, kann diese Frage beantwortet werden. Somit können Kunst und Kultur „als Bereicherung für das eigene Leben erfahrbar“ gemacht werden – eines von zwölf von der BKJ zusammengefassten Argumenten für die zentrale Rolle, die kulturelle Bildung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen spielt.
Nichtsdestotrotz stehen sowohl die kulturelle Bildung im Allgemeinen als auch das literarische Übersetzen als Praxis derselben vor der Herausforderung, auf die Bedürfnisse junger Menschen aus benachteiligten Milieus einzugehen. Diesbezüglich weist der EDUCULT-Vorstandsvorsitzende Michael Wimmer darauf hin, dass Kunst nicht nur Integrations-, sondern auch Segregationspotential habe: für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Milieus ist „Kunst, jedenfalls im Selbstverständnis eines professionellen Kunstbetriebs … nicht Teil ihrer Lebenswelt und wird daher beispielsweise im schulischen Kontext zuerst einmal als Medium der Ausgrenzung und der Nichtzugehörigkeit erfahren.“ Daher bedürfe es sogenannter „Dritter Räume,“
die die bestehenden Machthierarchien nicht einfach negieren, sondern in einer Weise thematisieren, die sie zumindest im ästhetischen Spiel handhab- und damit veränderbar machen. Dabei besteht die Herausforderung darin, sich von unterschiedlichen Enden aus, gemeinsam erfahrbaren kulturellen Wertvorstellungen zumindest anzunähern. Künstlerische Verfahren, die ganzheitliche sinnliche Erfahrungen ermöglichen, können helfen, den Selbstwert junger Menschen in einer ansonsten als weithin diskriminierend erfahrenen Gemeinschaft zu erhöhen.
Als Angebot der kulturellen Bildung erfüllt das literarische Übersetzen diese Anforderungen per se, da es auf den Prozess des Übersetzens und nicht das künstlerische Ausgangs- oder Endprodukt abzielt. Anstelle eines Kunstwerks steht also eher das künstlerische Verfahren im Mittelpunkt. Gekoppelt mit einem diversen Angebot an Ausgangs- und Zielsprachen, Genres und Medien, wie sie im Projekt echt absolut realisiert sind, kann das literarische Übersetzen als Angebot der kulturellen Bildung Kindern und Jugendlichen den Umgang mit einem Werkzeug vermitteln, mit dem Kunsterfahrung zu Welterfahrung wird.
Literatur
Baer, Brian James. „Teaching literature in translation.“ The Routledge Handbook of Literary Translation. London & New York: Routledge 2019, S. 58-71.
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (Hrsg.). „Gute Praxis machen. Woran man gute Angebote Kultureller Bildung erkennt.“ Webseite der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung. https://www.bkj.de/grundlagen/was-ist-kulturelle-bildung/prinzipien-der-kinder-und-jugendkulturarbeit/ [Zugriff: 30.03.2022].
—. „Argumente für Kulturelle Bildung. Warum Kulturelle Bildung wichtig ist.“ Webseite der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung.
https://www.bkj.de/grundlagen/was-ist-kulturelle-bildung/argumente-fuer-kulturelle-bildung/ [Zugriff: 10.04.2022].
echt absolut. Webseite des Projekts echt absolut. https://echtabsolut.de/info/ [Zugriff: 10.03.2022]
„Kulturelle Bildung.“ Webseite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/kulturelle-bildung/kulturelle-bildung_node.html [Zugriff: 10.03.2022].
Leupold, Gabriele. „Ketten und Spielraum. Entscheidungen beim Übersetzen.“ In Ketten tanzen. Übersetzen als interpretierende Kunst. Göttingen: Wallstein 2012. urn:nbn:de:101:1-201212201032.
Randol, Shaun. „Interview with Susan Bernofsky.“ Words without Borders. The Online Magazine for International Literature. 2013.
https://www.wordswithoutborders.org/dispatches/article/interview-with-susan-bernofsky [Zugriff: 10.03.2022].
Robinson, Douglas. Who Translates? Translator Subjectivities Beyond Reason. New York: State University of New York Press 2001.
Schrödter, Mark. „Perfektion bitte?!“ kubi. Magazin für Kulturelle Bildung. No. 19-2020, S. 27-29.
Wimmer, Michael. „Dritte Orte finden sich dort, wo soziale Ungleichheit aufeinander trifft.” kubi. Magazin für Kulturelle Bildung. No. 20-2021, S. 11-15.
Juliane Schallau ist 1992 in Frankfurt (Oder) geboren und promoviert im Fachbereich Amerikanische Literatur und Kultur an der Universität Potsdam über Zeitlichkeiten von Schuld im Werk William Faulkners. Von 2018 bis 2021 war sie im Literarischen Colloquium Berlin unter anderem für die Betreuung des Grenzgänger-Förderprogramms sowie des Online-Tonarchivs Dichterlesen.net zuständig und übersetzte englischsprachige Beiträge des Nachrichtenportals LCB diplomatique ins Deutsche. Seit 2022 arbeitet sie in der Kommunikationsabteilung der American Academy in Berlin.
Literaturübersetzen mit Kindern und Jugendlichen …? Echt jetzt? – Ja, absolut.
Ein Essay von Miriam Denger
Pilotprojekte, wie das 2018 vom Deutschen Übersetzerfonds initiierte Programm „echt absolut – Literaturübersetzen mit Kindern und Jugendlichen“ erobern unkartiertes Gelände: Bei der Planung lässt sich kaum auf konkrete Erfahrungen zurückgreifen, oft stellt sich erst unterwegs heraus, in welche Richtungen die Reise gehen kann. Das Konzept sieht vor, Kinder und Jugendliche mit professionellen Literaturübersetzer:innen in Workshops zusammenzubringen, sei es in schulischem oder außerschulischem Rahmen. Es gilt, mögliche Partnerinstitutionen (Schulen, Literaturhäuser, Theater, Universitäten, Radiosender, soziale Einrichtungen u.a.) mit ins Boot zu holen und Teilnehmende zu gewinnen. Im Vorfeld sind Übersetzer:innen daher mit ganz pragmatischen Fragen zu ihren Projekten konfrontiert, beispielsweise nach dem Mindestalter für ihre jeweiligen Angebote, der aktuell bevorzugten Lektüre von Jugendlichen oder dem voraussichtlichen Anteil mehrsprachiger Kinder in den Arbeitsgruppen.
Hinter diesen konkreten, auf die individuelle Workshopplanung bezogenen Fragen, treten komplexere und übergeordnete Themen zutage: bildungspolitische, wissenschaftliche, gesellschaftliche Aspekte, die Problematik sozialer Strukturen und des Zugangs zu kultureller Teilhabe. Im Folgenden sollen einige dieser Aspekte herausgegriffen und näher beleuchtet, ihre Implikationen hinsichtlich des Projekts Echt absolut reflektiert werden. Schwerpunkt ist dabei der schulische Kontext. Für die Zielgruppe stellt sie (neben der Familie) den Hauptlernort dar, zu dem sich auch außerschulische Bildungsangebote positionieren müssen.
Braucht Literaturübersetzung einen festen Platz in schulischen Curricula?
Seit Pisa[1] als dunkler Schatten am bildungspolitischen Horizont aufgetaucht sind, stehen die ökonomischen Aspekte bei einschlägigen Diskussionen meist im Vordergrund, sind Messbarkeit und Standardisierung von ‚Kompetenzen‘ immer wichtiger geworden. Die stärker mit Werten der Persönlichkeitsbildung und der ästhetischen Bildung betrauten Fächer (musische Fächer, Sprachunterricht, Gesellschaftswissenschaften, Ethik, Religion, Philosophie) stehen nun unter wachsendem Legitimationsdruck, insbesondere im Vergleich zu den MINT-Fächern, die objektivere und messbarere Leistungsvergleiche ermöglichen und einen unmittelbareren Anwendungsnutzen versprechen. Aus dem Blickfeld geraten so das Potenzial z.B. der ästhetischen Bildung (im Sinne ergebnisoffener künstlerischer Arbeit mit den Beteiligten) und die dadurch evozierten Wirkungen. Selbst Fürsprecher:innen dieser angeblich „weichen“ Fächer bedienen daher häufig Legitimationsdiskurse, die Sekundäreffekte als eigentlichen Nutzen ausgeben, argumentieren mit arbeitsmarktkonformen „‚Kompetenzen‘ oder social skills, betonen die Bedeutung von „Kreativität“ als Ressource der Wirtschaft. Doch damit wird künstlerische Bildung auf die Vermittlung kreativitätsfördernder Methoden reduziert sowie jegliche Form der Persönlichkeitsbildung auf ihre ökonomische Verwertbarkeit. Die vorauseilende Übernahme solcher Diskurse ist eine „Selbstverzwergungsfalle“, in die auch Übersetzer:innen im schulischen Kontext leicht geraten.
Natürlich treffen einige der landläufigen Annahmen zu: Übersetzen trainiert sprachliche Fähigkeiten und schriftlichen Ausdruck, Literaturunterricht erweitert Weltwissen, beim Theaterspielen lässt sich selbstsicheres Auftreten üben, sowie im Kunstunterricht kreative Problemlösefähigkeiten – doch mit welchem Ziel? Das perfekt formulierte Bewerbungsschreiben, das bravourös gemeisterte Bewerbungsgespräch…? Auch dann, wenn solche Formulierungen nur für „Antragslyrik“ oder zur Elternbeschwichtigung erdacht werden, sind sie problematisch. Schüler:innen haben ein ausgeprägtes Gespür für den Stellenwert einer Disziplin im hierarchischen Fächergefüge und teilen schnell die auch allgemein verbreitete Geringschätzung sogenannter „Laberfächer“.
Nach welchen Kriterien entstehen eigentlich Lehrpläne und nach welchem Schema teilt man Schulstoff in Fächer? Was sollten Schüler:innen lernen? Weil sich alles immer schneller verändert, die Gesellschaft komplexer wird, das verfügbare Wissen und die Verfügbarkeit von Wissen permanent exponentiell anwachsen, wird diese Frage zunehmend relevanter. Wie entscheidet eine Generation, welches Wissen und welche Fähigkeiten die ihr nachfolgenden Generationen später einmal benötigen? Die schließlich getroffene Auswahl bleibt immer auch eine spekulative Wette auf die Zukunft.
Persönliche und ästhetische Bildung nicht der ökonomischen Verwertbarkeit zu unterwerfen, andererseits aber Bezüge zur Lebensrealität der Lernenden herzustellen, ist eine ständige Gratwanderung. Schüler:innen lernen dann am besten, wenn sie Verbindungen zwischen dem Erlernten und ihrer eigenen Welt herstellen können. Haben sie hingegen das Gefühl, das Erlernte hätte nichts mit ihnen zu tun, verlieren sie schnell die Motivation. Mögliche Verbindungen zwischen Schüler:innen und Lernstoff sind individuell verschieden. Das in dieser Debatte beliebte Argument, Schulwissen müsse grundsätzlich nicht auf seine praktische Anwendung hin ausgerichtet sein, führt letztlich ebenso wenig weiter wie das Gegenteil – die Reduktion und die Vereinnahmung von Schulwissen für bestimmte Zwecke, etwa die Wirtschaft. So brachte der bayrische Ministerpräsident in einer umstrittenen Wortmeldung im Kontext der Pandemie zum Ausdruck, Kita und Schule seien primär dazu da, um „die Wirtschaft am Laufen zu halten“.[2]
Fragt man Schüler:innen selbst, was ihnen in der Schule auf dem Lehrplan fehlt, lautet die Antwort oft „praktisches Alltagwissen“ oder sie wünschen sich, in der Schule mehr über „zwischenmenschliche Aspekte“ zu erfahren. „Steuern verstehen lernen“, „Finanzen, Geld, Versicherungen“, „Ernährung“, „Gut mit sich und anderen umgehen“, „Programmieren, Kompetenzen im Umgang mit Computern“, aber auch: „Das Klima retten“ sind weitere Antworten. Rezo, Influencer und Sprachrohr der jüngeren Generation, kritisiert in einem seiner Songs mit dem Titel „Warum Schule keinen Sinn macht“[3], auf ironische Weise eine Lernkultur, die seiner Meinung nach immer noch vor allem auf das Auswendiglernen von Inhalten setzt: „Unnötiges Wissen pauken, wenn es Wikipedia gibt, ist (überhaupt nicht) Zeitverschwendung“. Wie schon die Schülerin Naina in ihrem 2015 viral gegangenen Tweet[4] führt er dabei als negatives Lieblingsbeispiel die klassische Gedichtanalyse an, die von vielen Schüler:innen im Unterricht als besonders lebensfremd empfunden wird.
Schon diese beiden Wortmeldungen aus der (erweiterten) Zielgruppe machen deutlich, dass es auch für workshopleitende Übersetzer:innen essenziell wichtig ist, eine Verbindung zwischen den von ihnen vermittelnden Inhalten zur Lebensrealität ihrer Teilnehmenden herzustellen – insbesondere, wenn es sich dabei um Literatur handelt. Wichtig ist, anschaulich zu machen, welche mögliche Relevanz das Übersetzen, insbesondere das literarische, für die Gesellschaft insgesamt hat.
Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es verschiedene Wege. In den ersten Echt absolut – Workshops wurden z.B. Songtexte übersetzt, die wiederum in einer von Jugendlichen selbstgemachten Radiosendung vorgestellt wurden, oder ein Theaterstück für einen kooperierenden Jugendtheaterclub übersetzt. Hier haben die Teilnehmenden also ein konkret anwendbares Ziel, auf das sie hinarbeiten, das für sie selbst wie auch für andere von unmittelbarem, einleuchtenden Nutzen ist, öffentlich vorgestellt wird und Anerkennung findet. Auch das Auftreten als Tandem, Autorin mit ihrer Übersetzerin gemeinsam mit den Schüler:innen im Gespräch, wurde von den betreffenden Schüler:innen gut angenommen, da sie über das Wechselspiel der beiden auf anschauliche Weise viel über den Entstehungsprozess von Literatur und Büchern erfahren konnten.
Tritt man einen Schritt zurück und lässt das „Literatur“ vor dem „Übersetzen“ einen Moment beiseite und fragt sich zunächst einmal, welche Rolle Sprachen und Übersetzen im Leben von Jugendlichen im Jahr 2022 spielen, rückt unweigerlich in den Blick, dass gerade unter Schüler:innen der Anteil von Menschen in Deutschland mit dem sogenannten Migrationshintergrund besonders hoch ist. Das „mehrsprachige Klassenzimmer“ ist längst eine Realität – wenn auch nach wie vor eine von Schulpolitik und Lehrplanmacher:innen weitgehend ignorierte. Hier könnte „Übersetzungsunterricht“ ansetzen.
Das mehrsprachige Klassenzimmer
Während wissenschaftlich heute weitgehend Einigkeit über die positiven Auswirkungen von Mehrsprachigkeit herrscht, schüren Politiker:innen immer noch gerne Ängste mit diesem emotional aufgeladenen Thema. Deutschkenntnisse gelten als einer der wichtigsten Maßstäbe gesellschaftlicher Integration, Mehrsprachigkeit im Umkehrschluss als eine Bedrohung, die bekämpft wird. In die Schlagzeilen geriet 2020 z.B. ein Fall, bei dem zwei Mädchen auf einem Schulhof mit einer Unterhaltung auf Türkisch gegen das „Deutsch-Sprechgebot“ ihrer Schule verstießen und dafür sanktioniert werden sollten.[5] Die anschließende Debatte machte darüber hinaus deutlich, wie unterschiedlich einzelne Sprachen bewertet werden: schwer vorstellbar, dass ein Pausenhofgespräch in einer schulrelevanten Sprache wie Englisch oder Französisch die Gemüter in ähnlicher Weise erhitzt hätte.
Deutschland ist de facto ein vielsprachiges Land, doch im Schulsystem spiegelt sich dieser Umstand nach wie vor ungenügend wider. Auch in der Öffentlichkeit setzt sich erst allmählich die Erkenntnis durch, dass die Vielfalt an Herkunftssprachen der Kinder und Jugendlichen eine wichtige Ressource darstellt, die es entsprechend zu fördern gilt – was auch bedeutet, die ungleiche Gewichtung von Sprachkenntnissen abzubauen. Vorschläge dazu gibt es viele. So verwies z.B. der Rat für Migration[6] 2020 darauf, dass Kinder, bei denen zuhause nicht Deutsch als Muttersprache gesprochen wird, in der Praxis häufig deswegen nicht das Gymnasium (und somit später möglicherweise eine Hochschule) besuchen, weil die Abiturvoraussetzung „zweite Fremdsprache“ (i.d. Regel Französisch, Latein, Spanisch oder Russisch, mind. Niveau B1) für sie bedeutet, eine dritte oder sogar vierte Sprache lernen zu müssen, zusätzlich zu der Herausforderung, den Abiturstoff auf Deutsch, also ebenfalls einer Nicht-Muttersprache, prüfungsreif zu beherrschen. Der (vergleichsweise niedrigschwellige) Vorschlag des Rats, einen Rechtsanspruch auf Prüfungen in den jeweiligen Herkunftssprachen einzuführen (und somit alle Sprachen gleichwertig zu behandeln) wurde von der Kultusministerkonferenz vom Tisch gewischt.
Andere interessante Vorschläge, wie etwa der, ein allgemeines Grundlagenfach „Sprache und Kommunikation“[7] einzuführen, welches metasprachliche Fähigkeiten und Wissen von Schüler:innen fördern könnte, wurden in der Diskussion erst gar nicht ernsthaft aufgegriffen. Aus Übersetzer:innensicht jedoch ist genau diese Idee interessant, denn gerade ein solches Fach könnte der geeignete Rahmen für das Vermitteln übersetzerischer Fähigkeiten innerhalb des schulischen Curriculums sein.
Unstrittig ist, dass die Voraussetzungen der Schüler:innen für das Projekt „(Literatur-) Übersetzen“ im schulischen Kontext sehr unterschiedlich ausfallen, eine Herausforderung, auf die eine potenzielle Workshopleitung reagieren muss. Das könnte z.B. durch das bewusste Aufwerten der vom Bildungskanon weniger beachteten Sprachen sowie dem Selbstbewusstsein ihrer Sprecher:innen geschehen. Dazu bedarf es unterschiedlichster Ansätze, die sich sowohl mit der Literatur und kulturellem Background dieser Sprachen auseinandersetzen als auch explizit mit dem Potenzial, das mehrsprachige Kinder mitbringen. Sobald ein Angebot sämtlichen interessierten Kindern und Jugendlichen offenstehen soll, ist es unabdingbar, auch unabhängig von der Sprachkombination der jeweiligen Lehrperson tragfähige Konzepte zu entwickeln. Es gilt außerdem zu berücksichtigen, dass in heterogenen Gruppen sowohl einsprachig als auch mehrsprachig aufgewachsene Teilnehmende zusammenkommen. Für mehrsprachig Aufgewachsene gehören verschiedene Formen der Sprachmittlung und Translation (im weitesten Sinne) oft zum familiären Alltag. Die Praxis hat gezeigt, dass sie selbst dies häufig gar nicht als besondere Kompetenz betrachten. Vom Bewusstmachen dieser durch Erfahrung erworbenen Fähigkeiten, bei gleichzeitiger Vermittlung professioneller Basics würden gerade diese Teilnehmenden besonders profitieren.
20 Jahre nach der ersten Pisa-Studie und einige Jahre nach den jüngsten Migrationsbewegungen, bei der überwiegend Menschen aus Syrien, Afghanistan und zuletzt der Ukraine nach Deutschland kamen, muss der aktuelle Stand der Debatte zum Thema „Mehrsprachigkeit“ umso mehr verwundern (und das gilt auch für den löchrigen Flickenteppich der Fördermöglichkeiten von Herkunftssprachen je nach Stadt, Bundesland, Region).
Warum aber nimmt das Thema „Übersetzen“ in dieser Diskussion so auffällig wenig Raum ein, warum stößt man bei Sprachlehrer:innen mitunter sogar auf regelrechte Vorbehalte dagegen? Ein Blick auf die Entwicklung des schulischen Sprachunterrichts in den letzten hundert Jahren hilft, diese Frage zu beantworten.
Die langen Schatten der Grammatik-Übersetzungs-Methode in der Schule
Dass weder Übersetzungswissenschaft noch Fremdsprachendidaktik sich mit dem Thema Übersetzen ernsthaft auseinandersetzen, hat auch historische Gründe. Die Grammatik-Übersetzungs-Methode, die jahrhundertelang dominierende Methode des Fremdsprachenerwerbs, kam im 20. Jahrhundert völlig außer Mode. Mit der Einführung von Französisch und Englisch als Unterrichtsfächer rückte die gesprochene Sprache in den Vordergrund, das Erschließen und Verstehen griechischer und lateinischer Texte durch Übersetzung dagegen galt zunehmend als veraltet – mit der Folge, dass Fremdsprachendidaktik heute kaum noch deren Potenziale nutzt und das Übersetzen im schulischen Kontext ein Nischendasein fristet. Und die Annahme, man müsste eine Sprache nur gut genug beherrschen, um sie dann auch automatisch übersetzen zu können, ist auch in Fachkreisen noch nicht ausgestorben – dabei längst schon widerlegt: Bilinguale Menschen sind keineswegs per se bessere Übersetzer:innen – translatorische Kompetenzen müssen als eigenständige Fähigkeiten betrachtet werden.
Mit der schon 1882 erschienenen Streitschrift Wilhelm Viёtors „Der Fremdsprachenunterricht muss umkehren. Ein Beitrag zur Überbürdungsfrage“[8] beginnt die Reform des Sprachenlernens. Viëtors Prinzipien (Primat der gesprochenen Sprache, Grammatiklehre als Mittel zum Zweck, Einsprachigkeit des Unterrichts, Motivation als Voraussetzung für erfolgreiches Lernen) bilden auch heute noch die Grundlagen des modernen Fremdsprachenunterrichts. Die Grammatik-Übersetzungs-Methode dagegen avancierte mit der Zeit zum Lieblings-‚Feindbild‘ aller Folgemethoden, die sich insbesondere in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelten, und die sich über Abgrenzung zu legitimieren versuchten: allen voran die „‚direkte Methode‘, gefolgt von der auf ihr aufbauenden ‚audiolinguale Methode‘ bis zum ‚kommunikativen‘ und ‚interkulturellen‘ Ansatz. Auch wenn moderner Fremdsprachenunterricht sich heute durch die Vielfalt seiner Methoden auszeichnet, erscheint Übersetzung überall dort als Hindernis, wo die direkte Anwendbarkeit einer neu zu lernenden Sprache als Priorität und zum obersten Unterrichtsziel ausgegeben wird. Die Sprache soll möglichst ohne Umwege erlernt werden, und das Übersetzen scheint zunächst ein solcher Umweg zu sein. Stattdessen sollen Lernende ein neues, selbständiges Sprachsystem aufbauen. Vor dem Hintergrund der historisch gewachsenen Tabuisierung der Muttersprache im Fremdsprachenunterricht wird die Aversion gegen Übersetzen als Methode zum Sprachenlernen verständlicher. Immer wieder wird auch betont, Übersetzen sei keine der von der Schule zu vermittelnden vier wesentlichen Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) und habe daher keinen Platz im (Fremdsprachen-)Unterricht.
Für werdende Workshopleiter:innen kann das bedeuten, dass sie im Rahmen von schulischen Kooperationen bei Fachlehrer:innen möglicherweise auf Skepsis stoßen. Ihre Teilnehmenden dagegen sind vielleicht noch nie mit systematischen Übersetzungsübungen in Berührung gekommen. Doch Erkenntnisse der Neurolinguistik geben Befürworter:innen der ungeliebten Methode in jüngerer Zeit zumindest teilweise recht: das Gehirn nutzt beim Sprachenlernen auch Strukturen, die es bereits im Mutterspracherwerb angelegt hat. Sprachenlernen beginnt nicht im luftleeren Raum, sondern baut auf den metasprachlichen Erkenntnissen und Mustern auf, die durch bereits erworbene Sprachen im Gehirn angelegt wurden. Übersetzung kann ein Mittel zur Förderung des fremdsprachlichen Lernens und des Sprachbewusstseins darstellen, vorausgesetzt, im Lernprozess wird die Beziehung von Muttersprache zur erlernenden Sprache nicht vollständig ausgeklammert.
Partners in crime – mögliche Verbündete des Literaturübersetzens in der Schule
Doch es gibt, neben dem Fremdsprachenunterricht, weitere, alternative, „Verbündete“ des Literaturübersetzens im schulischen Kontext, sowohl Inhalte als auch Methoden betreffend: Theaterpädagogik, zum Beispiel, oder Kreatives Schreiben. Beide Unterrichtsverfahren haben sich im Lauf der letzten Jahrzehnte beharrlich (jedoch auf unterschiedlichen Wegen und mit unterschiedlichen Ergebnissen) ihren festen Platz auf den Lehrplänen erobert. Beiden liegt das Prinzip des spielerischen Ausprobierens zugrunde. Schüler:innen wird zugetraut, eigene (künstlerische) Entscheidungen zu treffen und die dafür notwendigen Eigenschaften mitzubringen – oder sie sich ggf. im Laufe des Prozesses aneignen zu können.
Wo liegen nun für das literarische Übersetzen fruchtbar zu machende Überschneidungen und Anknüpfungspunkte? Kreatives Schreiben und Theater schaffen Zugänge zu Literatur und Sprache, wie sie durch Lektüre und Literarturunterricht allein nicht zustande kommen. Beides sind spielerische Erkundungsprozesse, die keinem professionellen Erfolgsdruck unterliegen (sollten), sondern bei denen die Möglichkeit des Scheiterns Voraussetzung ist. Ergebnisse sind nicht festgelegt, sie entstehen erst im Prozess, werden erschrieben und erspielt. Die Aufgabe der Anleitenden ist es, Dinge zu ermöglichen, Spielräume zu eröffnen. Sprache wird im Spiel zu einer an Bewegung gebundenen, körperlichen Erfahrung: zu Atem, Klang und Rhythmus im Raum; die szenische Qualität von Situationen und Begegnungen wird dreidimensional erfahrbar. Teilnehmende werden für dramaturgische und inszenatorische Entscheidungen sensibilisiert oder auch selbst in diese eingebunden. Diese Entscheidungsprozesse im theatralen Prozess wiederum sind im Kern denen sehr ähnlich, die beim Übersetzen getroffen werden müssen. Oder, mit den Worten Antoine Vitez‘: „Übersetzen und Inszenieren ist die gleiche Arbeit, ist die Kunst, innerhalb der Zeichenhierarchie zu wählen“.[9]
Anhand von Theater lässt sich leicht über Genres und unterschiedliche – auch literarische Traditionen – sprechen. Im Besten Fall sind Theaterbesuch und Theaterspielen sich ergänzende Erfahrungen. So wie Musiker:innen in Konzerte gehen, bildende Künstler:innen Ausstellungen besuchen – und Schriftsteller:innen und Übersetzer:innen Literatur lesen. Je nach Theaterform fallen diese Erfahrungen der Teilnehmenden unterschiedlich aus. Ein Stück, das stark auf chorisches Sprechen setzt, ermöglicht seinen Spielenden andere Zugänge zu Sprache und andere Situationen auf der Bühne als etwa das Spielen einer „Rolle“ im klassischen (Theater-)Sinn, die Spielende sich individuell erarbeiten: Wie bewegt sich meine Figur, wie sieht sie aus, welche Kleidung trägt sie, was macht ihre Erscheinung aus, wie spricht sie, welche sprachlichen Eigenschaften sind charakteristisch für sie? Hat sie z.B. einen Dialekt oder einen Sprachfehler? Welchen sozialen Status nimmt sie gegenüber anderen Figuren ein? Wie sind Dialoge aufgebaut, auf welchen Auslöser, auf welches Stichwort kann ein Gegenüber im Spiel reagieren? Wie verändert sich der Status im Laufe einer Szene, im Laufe des Stücks? Was sagt eine Figur, was sagt sie nicht, was will sie eigentlich sagen? Wieviel Interpretationsspielraum bleibt den Spielenden, wieviel den Zuschauenden? In welchem historischen Kontext sind Stücktexte entstanden, gegen was richten sie sich, was wird verhandelt? Neben der spielerischen Erweiterung von Weltwissen wirkt sich Theaterspielen nachweislich außerdem auf psychosozialer Ebene auf die Spieler:innen aus; es erzeugt ähnliche Effekte, wie sie der Lektüre anspruchsvoller Literatur gerne zugeschrieben werden: Spielende entwickeln eine höhere Empathiefähigkeit, können sich besser in andere hineinversetzen, andere Perspektiven einnehmen. Sie können ihnen unbekannte emotionale Register ausprobieren (und das ist insbesondere für Heranwachsende von großer Bedeutung), können Teil von Geschichten werden, die weit über ihre eigene Person und ihr bisheriges Leben hinausreichen, sie können sich in neuen sozialen Konstellationen begegnen und körperlich ausdrücken, gemeinsam ein Team bilden, in dem die jeweils individuellen Stärken gewahrt werden. Sie können Welten erschaffen und Dinge ausprobieren, zu denen sie in ihrem Alltag kaum Gelegenheit haben und dabei unterschiedlichsten Figuren unter die fiktive Haut schlüpfen. Das alles sind Vorgänge, wie sie sich ganz ähnlich auch beim literarischen Übersetzen abspielen.
Lehrkräfte, die Kreatives Schreiben unterrichten, stellen immer wieder fest, dass ihre Schüler:innen gerne schreiben, wenn sie über Dinge schreiben dürfen, für die sie sich interessieren. Das Ziel dabei ist nicht, aus allen Schüler:innen Schriftsteller:innen zu machen, sondern Schreiben für die Teilnehmenden zu einer möglichst lustvollen Tätigkeit werden zu lassen, die Spaß macht. Anleitung kann dabei helfen, die je individuellen Ausdrucksfähigkeiten zu entwickeln.
Eine Aussage, die sich 1:1 auf das Angebot von Literarischem Übersetzen für Kinder und Jugendliche übertragen lässt!
Quintenzirkel – Musik oder Mathematik?
Kreatives Schreiben und Theaterspielen berühren im Kern die Frage, warum Menschen sich Geschichten erzählen, wie und warum das für Gesellschaften durch die Jahrhunderte durch Bedeutung hatte und hat, warum erfundene Gefühle in einem Buch, im Theater, im Kino uns emotional tief bewegen können. Sind Schüler:innen darin selbst, mit ihrer Persönlichkeit, ihren Fähigkeiten und Themen eingebunden (und das ist nicht bei jeder Schultheaterinszenierung, bei der Lehrer:innen zu dominanten Hobby-Regisseur:innen mutieren, der Fall… ) können so Antworten auf diese Fragen gesucht werden, in einer für (junge) Menschen viel sinnlicher erfahrbaren Art und Weise als im Frontalunterricht. Dieses „Warum“, der Sinn, die Frage, warum man sich beispielsweise überhaupt noch mit Literatur beschäftigen sollte, die schon vor Jahrhunderten geschrieben wurde, ist von entscheidender Bedeutung, um für Jugendliche Zugänge zu schaffen, denn auch für das Literarische Übersetzen gilt, dass Zugang finden kann, wer Teil kultureller Praxis ist. Bleibt man passive:r Beobachter:in, bleiben viele Kulturtechniken zwangsläufig abstrakt. Wer kein Instrument spielt, sieht im Quintenzirkel nichts als reine Mathematik, wer nie selbst ein Bild gemalt oder eine Skulptur erschaffen hat, dessen Blick bleibt im Museum angesichts der dort ausgestellten Werke zwangsläufig beschränkt. Und nebenbei regt z.B. das Kreative Schreiben die Entwicklung eines persönlichen Schreibstils an, erweitert den Wortschatz, verbessert die Rechtschreibung, steigert die Fähigkeit, die eigene Wahrnehmung zu reflektieren, Phänomene zu beschreiben, Dinge zu benennen.
Reality bites
Angesichts der derzeitigen Situation an den Schulen klingen solche Ideen in vielen Ohren vermutlich erst einmal weltfremd. Lehrernmangel, Überlastung, drohender Burn-Out, dazu kommen die oft starren und meist unumgänglichen Vorgaben des Systems, außerdem Digitalisierung, die Organisation von Ganztagsangeboten, die Pandemie, die steigende Zahlen geflüchteter Kinder, vermehrte psychische Probleme von Lernenden, immer weiter höhere gesellschaftliche Erwartungen an das System Schule und damit an das, was Lehrer:innen alles leisten sollen. Dazu seit Jahren die Pisa–Evaluationen, die weiter Druck aufbauen, Ergebnisse möglichst mess- und vergleichbar machen möchten. Und tatsächlich klingt die Diagnose alarmierend: 21% der 15-Jährigen könnten demnach nicht sinngestaltend lesen[10]. Sprachstandserhebungen der Bundesländer ergaben, dass jedes vierte Kind mit fünf oder sechs Jahren Sprachförderung braucht – Rückstände, die Schüler:innen nicht selten durch ihre ganze Schullaufbahn hindurch mitschleppen müssen. Angesichts dessen werden Stimmen laut, dass die Lektüre klassischer Werke, wie etwa „Faust“, im Unterricht überfordere, stattdessen solle man sich auf Basics wie Rechtschreibung konzentrieren – und tatsächlich dürften auch viele Lehrer:innen froh sein, wenn ihre Klassen das Lesen und Schreiben besser beherrschen würden, bevor sie über Literaturübersetzen mit Kindern und Jugendlichen auch nur ansatzweise nachdenken. Kann man es ihnen übelnehmen?
Dass Schule häufig starr und unflexibel ist, ist nicht die Schuld der Lehrer:innen. An dieser Stelle soll zwar nicht vertieft auf die herrschende, und seit Jahrzehnten immer lauter werdende Kritik am Schulsystem generell eingegangen werden[11], doch auch immer mehr Erkenntnisse aus der Kognitions- und Hirnforschung zeigen, wie gutes Lernen funktionieren könnte – und dass diese beispielsweise dem vorgegebenen Rhythmus von 45 min pro Unterrichtseinheit oder der in den weiterführenden Schulen immer noch bestehenden Fächereinteilung diametral entgegenstehen. Für die Fragestellung „aus welchen Erfahrungen und Methoden z.B. der Theaterpädagogik können sich Konzepte für das Literarische Übersetzen mit Jugendlichen bedienen“ könnte schon der eigentlich simple Hinweis interessant sein, dass z.B. das Erlernen von Vokabeln einfacher wird, wenn es durch Gestik und Bewegung unterstützt wird.[12]
Demokratie und Teilhabe
Die Frage, ob Literaturübersetzen für Kinder und Jugendliche nicht zu anspruchsvoll sei, ist berechtigt. Denkt man über eine mögliche Integration, auch externer Angebote, in Schulen und Lehrpläne nach, wird deutlich, dass solche Angebote für eine größtmögliche Schüler:innengruppe zugänglich sein sollten, wenn man damit nicht nur Abiturient:innen in Leistungskursen erreichen will. Auch bringen manche Schüler:innen durch ihren familiären Hintergrund mehr literarische Vorbildung mit als andere. Das Übersetzen von Literatur setzt viele sprachliche Fähigkeiten voraus – und eben auch, wie selbstverständlich, überhaupt erst den Zugang zu Büchern und deren Lektüre.
Für längerfristig und umfassend angelegte Konzepte ist daher die Idee, Literatur und Übersetzung erst einmal zu trennen, möglicherweise sinnvoll, und sich stufenweise erst mit dem Phänomen von Mehrsprachigkeit und Übersetzen zu beschäftigen, bevor man Literatur und Lektüre einsteigt. So könnten auch die „Literaturmuffel“ zumindest teilweise von der Beschäftigung mit dem Konzept „Übersetzen“ profitieren. Doch auch die Vermittlung von Schullektüre hängt in hohem Maße davon ab, wie sie durchgeführt wird. In einem Artikel im „Spiegel“[13], der allgemeine Verbesserungsvorschläge für den Schulunterricht sammelt, wird eine neunte Klasse beschrieben, in der die Schüler:innen gemeinsam „Romeo und Julia“ lesen, jedoch mit unterschiedlichen Ausgaben – von der vereinfachten über die Schülerausgabe bis hin zur komplexeren Schlegel-Übersetzung. An die Klasse gestellte Aufgaben wurden von allen gemeinsam bearbeitet. Nebeneffekt: Den Schüler:innen wird bewusst, dass sie es mit unterschiedlichen Übersetzungen zu tun haben. Übungen zum Vergleich verschiedener Übersetzungen lassen sich so im Kontext der Schullektüre vergleichsweise leicht andocken.
Umstritten: Der Literarische Kanon[14] an Schulen
Kabale und Liebe, Frühlingserwachen, Effie Briest, Homo Faber – Gespräche über Schullektüre lösen selten Jubel aus, auch dann nicht, wenn die eigene Schulzeit schon Jahrzehnte zurückliegt. Schrifsteller:innen, Übersetzer:innen, andere beruflich mit Literatur befasste Menschen haben häufig trotz, nicht wegen solcher Erfahrungen zu ihrem Beruf gefunden. Dabei sind die Erwartungen, die mit dem Lektüreunterricht verbunden werden, groß, angefangen mit dem damit einhergehenden Lesekompetenztraining und der inhaltlichen Reflexion gesellschaftlicher Themen. In einem kürzlich in der TAZ erschienen Artikel[15] von Leander Steinkopf sprechen Schriftsteller:innen über ihre literarische Sozialisation in der Schule. Die Autorin Isabel Lehn z.B. wird dort wie folgt zitiert:
„Die Schullektüre hat mich eher daran zweifeln lassen, dass Literatur etwas mit meinem Leben zu tun hat. Eher hat sie mir ein abschreckendes Bild von ,Literatur’ vermittelt, von dem ich dachte, dass es wenig mit meinen Erfahrungen, meiner Perspektive und meiner Sprache zu tun hat. Bücher, die mich verändert, getröstet, begeistert, bewegt und zum Nachdenken gebracht haben, kamen erst später.“ [16]
Die Textauswahl im Deutschunterricht orientiert sich größtenteils an Empfehlungen und Vorgaben einer Kommission, die das Kultusministerium ernennt und die aus Lehrkräften, Literatur:wissenschaftler:innen und Bildungsforscher:innen besteht. Sie setzt sich u.a. nach verschiedenen Kategorien wie ‚literaturgeschichtlich relevant‘, ‚schülernah‘, ‚grundlegend philosophisch‘ zusammen. Oft wird Lektüre auch dazu eingesetzt, historische Zusammenhänge und Hintergründe zu verdeutlichen.
Dieser Kanon steht von verschiedenen Seiten unter Kritik. Bereits erwähnt wurde die Vermutung, die Lektüre klassischer Werke würden Schüler:innen überfordern, andere kritisieren, der Kanon sei zu weiß und zu männlich. Und tatsächlich stellt etwa die Unterrepräsentanz von Autor:innen auf schulischen Leselisten ein Problem dar, das weitreichende Folgen nach sich zieht.
Die Forderung, dass eine Bücherliste, die in der Schule als Empfehlung gilt, nach Geschlechtern ausgeglichen sein sollte, ist berechtigt und sollte in den 2020er Jahren eigentlich längst selbstverständlich sein. Schulbildung muss vermitteln, dass Perspektiven von Frauen, ihre Sicht auf die Welt, genauso viel zählen wie die von Männern. PD Dr. Martina Wernli widmet diesem diversity-gap 2021 ein ganzes Seminar an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, unter dem Titel „Kanon und Diversität“[17]. Darin lässt sie u.a. die Studierenden deren Lektürebiografen aufschreiben. Vielen von ihnen wird erst jetzt, im Uni-Seminar, rückblickend auf ihre Schulzeit, bewusst, dass sie keine oder kaum Bücher von Autorinnen gelesen haben – ohne diesen Umstand je zu registrieren oder zu hinterfragen. Stark kanonisierte Texte sind scheinbar unangreifbar, die Diskussion mit den Schüler:innen oder Student:innen über die Relevanz von Autor:innen wird selten gesucht. Die aktuellen, teils mehrfach preisgekrönten Autor:innen, die Wernli dann auf ihren eigenen Seminarplan setzte, waren den meisten hingegen überhaupt nicht bekannt, von Hengameh Yaghoobifarah, Sharon Dodua Otoo, Olivia Wenzel über Sasha Marianna Salzmann, Linus Giese, Deniz Utlu, Fatma Aydemir, Amanda Gorman bis zu Audre Lourde oder Yoko Tawada, sie hatten noch nie von ihnen gehört.
Augenscheinlich besteht hier ein gewisser Aufholbedarf. Mit ihrer eigenen Auswahl an Texten, Lektüre und Arbeitsbeispielen können Übersetzer:innen in ihren Workshops gezielt die literarische Bandbreite ihrer Teilnehmenden erweitern und sich bewusst für Inhalte entscheiden, mit denen diese sonst kaum in Berührung kämen. Doch auch neue Blicke auf Klassiker können bewusst gesucht werden, so lässt sich etwa anhand verschiedener Übersetzungen von bekannten Kinderbuchklassikern der Effekt thematisieren, dass eine Übersetzung schneller altert als ihr Original.
Entscheidend ist, wie begeistert Lehrer:innen Literatur als Sinnangebot vermitteln können, welche eigene Einstellung zur gemeinsam gelesenen Lektüre sie mitbringen. Denn wer für Literatur begeistern will, muss davon selbst begeistert sein. Wie jedoch bereits beschrieben, haben Lehrer:innen in der Praxis oft wenig Spielraum bei der Gestaltung ihrer Leselisten und die Begeisterung geht im stressigen Schulalltag leicht verloren.
Kann es also eine Lösung sein, den Autor:innen und Übersetzer:innen selbst den Literaturunterricht an Schulen zu überlassen? Eine provokante Frage. Das Modell „Künstler:innen in die Schulen“ ist nicht generell neu, solche und ähnliche Programme werden über die Jahre immer wieder aufgelegt. Auch Echt absolut gehört insofern dazu, als viele der Workshopleitenden sich für ein Angebot im schulischen Rahmen entschieden haben (auch, wenn das Literaturübersetzen an sich eine Premiere darstellt). Für Schüler:innen sind Begegnungen mit Menschen, die von außerhalb des Schulsystems zu ihnen in den Unterricht stoßen, ein Gewinn, Künstler:innen selbst dagegen geben häufiger ein skeptischeres Feedback, wenn sie gefragt werden, wie die Erfahrung für sie selbst gewesen sei und welche Anregungen sie selbst mitnähmen.
Theaterspielen und Kreatives Schreiben müssen nicht zwangsläufig von professionellen Künstler:innen angeleitet werden. Theaterpädagogik etwa ist längst eine eigene professionelle Ausbildung, die sich z.B. von der eines Schauspielers an einer Schauspielschule deutlich unterscheidet. Auch über Regie oder Dramaturgie finden viele Theaterleute zum Anleiten nicht-professioneller Gruppen, längst nicht alle stehen selbst auf der Bühne. Leiten primär als Pädagog:innen ausgebildete Anleiter:innen künstlerische Prozesse an, geht es in erster Linie darum, den für die Entfaltung der Schüler:innen nötigen Freiraum zu schaffen. Doch auch Künstler:innen, die Gruppen anleiten, müssen keine pädagogischen Expert:innen sein. Was sie jedoch dringend benötigen, ist ein Gespür für den schmalen Grat zwischem künstlerischen Anspruch und dem Wissen darum, dass statistisch pro Klassenzimmer gerade mal ein:e Schüler:in Schriftsteller:in, Autor:in oder Übersetzer:in wird.
Wichtig ist, die Reflexion der eigenen Rolle als Anleiter:in, die innere Haltung, die eigene Anpassungsfähigkeit, das Erkennen und Wahren eigener Grenzen. Wie alle Nicht-Lehrer:innen, die in der Schule ihren eigenen Beruf vorstellen, können sie dabei auch auf ein gewisses professionelles Charisma und eine natürliche, fachliche Autorität setzen. Für Schüler:innen können sie interessante Rollenmodelle sein, gerade weil sie ganz anders auftreten als die Lehrkräfte, von denen sie täglich unterrichtet werden. Dass man vom Literaturübersetzen nicht reich wird, kann, je nach Interesse der jeweiligen Altersstufe, ebenfalls im Rahmen einer Berufsvorstellung thematisiert werden.
Grundlegende, regelmäßige und längerfristige Einbindung von (literarischem) Übersetzen in Lehrpläne könnte vermutlich nicht allein von professionellen (Literatur-) Übersetzer:innen abgedeckt werden. Einmalige Projekte, wie bei Echt absolut bleiben für Schüler:innen daher meist eine Ausnahme. So sehr Kontakt und Austausch zwischen Profis, Künstler:innen und Schüler:innen zu begrüßen ist, bleibt auch die weiterhin kritisch zu erörternde Frage, bis zu welchem Grad das über die letzten Jahre immer weiter fortschreitende Outsourcing kultureller Bildung aus den Schulen an Träger wie Theater, Orchester, Museen und deren pädagogische Angebote sinnvoll ist, bzw. inwieweit die Integration künstlerischer Fächer innerhalb des Kosmos Schule dadurch leiden. Im Rahmen dieser Reflexion kann darauf leider nicht vertiefend eingegangen werden.
Alles nur Deko?
Einer weiteren drohenden Gefahr konnten auch Theaterpädagogik und Kreatives Schreiben auf ihrem Weg ins Schulsystem nicht vollständig ausweichen. Das wird schnell deutlich, wenn man in entsprechende Anleitungsbücher schaut: während Bücher wie etwa „Schreib! Schreib! Schreib! Die kreative Textwerkstatt“[18] sofort das Bedürfnis wecken, selbst zum Stift zu greifen, sind für die Schule gedachte Bücher zum Thema sehr verkopft, sehr regelorientiert und gefährlich nah an regulären Lehrwerken zum Deutschunterricht. Dort, wo kreative Inhalte in Lernbereiche integriert werden, und Kompromisse eingehen (müssen), laufen sie Gefahr, ihre Freiheit – und damit das, was sie ausmacht – zu stark zu begrenzen. Auch der Konflikt der Bewertbarkeit durch Schulnoten bleibt bestehen. Dort aber, wo künstlerische Elemente den Status von Sonderveranstaltungen (etwa Projektwochen) behalten, werden sie schnell zu ‚Beiwerk‘ reduziert, im regulären Unterricht zu Entspannungsübungen und Lückenfüllern degradiert. In dieses Spannungsfeld kann auch das Literaturübersetzen leicht geraten.
In den bereits erwähnten Lehrwerken zum kreativen Schreiben innerhalb des regulären Deutschunterrichts fällt außerdem auf, dass sie eine Methode sehr stark bevorzugen: das Kopieren literarischer Vorlagen, um so zu eigenem Textmaterial zu kommen. Dagegen ist per se nichts einzuwenden, wird Kreatives Schreiben jedoch nur auf diese Weise unterrichtet, verfehlt es sein Ziel. Den eigenen Stil an dem eines anderen Autor, einer anderen Autorin zu schulen, darf eben nur dem Zweck dienen, das eigene Handwerkszeug zu schärfen, um dann eigenen Inhalten und Anliegen Ausdruck zu verleihen, nicht aber (und der Verdacht liegt zumindest bei der Sichtung besagter Bücher nahe) primär dem Zweck dienen, etwa ein literarisches Werk besser zu verstehen, in dem man ein neues Ende dafür verfasst, einen Erlebnisbericht aus der Perspektive einer Nebenfigur schreibt oder ein Märchen rückwärts erzählt. Beschränkt es sich darauf, bleibt das Kreative Schreiben ein Anhängsel vom Literaturunterricht nach altem Rezept. Schreibanlässe und Freie Texte, die mit den Schreibenden selbst zu tun haben, gehören unbedingt in ausreichendem Maße dazu.
Das gesagt, soll aber der Blick noch einmal darauf gelenkt werden, dass gerade dieses „Malen nach Zahlen“, das Kreative Schreiben nach literarischen Vorlagen, für das Literarische Übersetzen mit Kindern und Jugendlichen wiederum durchaus interessante Methodische Ansätze bietet – weniger das Fortschreiben von Handlungssträngen als z.B. das Schreiben von Gedichten auf Grundlage bereits bestehender Gedichte. Dass das Kopieren von Stilen und Genres eine gute übersetzerische Übung sein kann, leuchtet ebenfalls unmittelbar ein. Denn ist Übersetzen, ketzerisch gefragt, letztlich so viel anders als Schreiben nach literarischen Vorlagen …?
Zum Schluss noch eine letzte Anmerkung zu einem lebensweltlichen Aspekt, mit dem vermutlich jede:r, der oder die sich vor eine Gruppe „digital natives“ stellt, um übers Übersetzen zu sprechen, konfrontiert wird: Warum verwenden wir keine KI, keinen automatischen Übersetzer, kein Google translate und kein Deepl zum Literarischen Übersetzen? Diese Frage entspricht der in früheren Zeiten formulierten Frage: „Warum muss ich das im Kopf rechnen und darf den Taschenrechner nicht dafür benutzen?“ auf die Lehrende damals meist antworteten: „Weil du später auch nicht immer einen Taschenrechner dabeihaben wirst“. Wir erinnern uns: Wenige Jahre später wurde das Smartphone erfunden, mit dem wir wie selbstverständlich immer auch einen Taschenrechner dabeihaben.
Workshopleiter:innen sollten dem Thema nicht aus dem Weg gehen, sondern ihm vielmehr offensiv begegnen, KI in ihre Workshops spielerisch miteinbeziehen, die Jugendlichen die Apps selbst erkunden lassen und sie selbst herausfinden lassen, wo Möglichkeiten und Grenzen dieses technischen Supports liegen. Die digitale Lebensrealität der Zielgruppe auszuklammern wäre auf jeden Fall eine vertane Chance.
Fazit
Lohnt es sich also, einen festen Platz für das (literarische) Übersetzen in der Schule zu suchen? Wenn ja, wo und wie könnte ein solcher am besten geschaffen wurden? Dazu wurden hier verschiedene Beobachtungen aus der Praxis reflektiert und verschiedene Ansätze beleuchtet. Deutlich wurde, wie wichtige Sprache, Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenzen längst nicht mehr nur im Hinblick auf internationale Beziehungen, sondern auch und gerade für das tägliche soziale Miteinander in Deutschland selbst ist. Mit Konzepten, durch die die bestehende Vielfalt aufgewertet, das Interesse an Sprache und die Fähigkeit zum Sprachtransfer in viele Richtungen geweckt wird, könnte (literarisches) Übersetzen mit Kindern und Jugendlichen einen wichtigen Beitrag zu einer offenen, demokratischen Gesellschaft leisten. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, die Idee eines übergreifenden Fachs „Sprache und Kommunikation“ weiterzudenken. Im Bereich des derzeitigen Sprachenunterrichts wäre genauer zu prüfen, wie die Grammatik-Übersetzungsmethode gezielt zum Spracherwerb eingesetzt werden könnte – möglicherweise kombiniert mit Unterrichtseinheiten zu den Grundlagen des Übersetzens an sich.
Übersetzer:innen, die sich auf das Abenteuer Schule einlassen wollen, dürfen sich von starren Systemen und kunst- und geistfeindlichem Schulalltag nicht abschrecken lassen. Praktischer orientierte Formate wie das Kreative Schreiben oder das Theaterspielen bieten weitere interessante Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit dem literarischen Übersetzen. Doch auch die eklatanten Defizite an Gegenwart und Blick über den eigenen Tellerrand, den schulische Leselisten auch 2022 noch offenbaren, können sich Literaturübersetzer:innen zunutze machen – in dem sie diese Lücken füllen, und dem Kanon etwas entgegensetzen. Im Rahmen von Echt absolut z.B. gab es auch Lesungen und Schulbesuche von Übersetzer:innen mit ‚ihren‘ Autorinnen.
Der größte mögliche Gewinn einer stärkeren Verankerung literarischen Übersetzens in der schulischen Bildung ist nicht sofort greif- oder gar ökonomisierbar. Er liegt in der Ermöglichung einer erweiterten Sicht auf die Welt, einer veränderten Haltung zu ihr. In seinem Buch „Die Vereindeutigung der Welt“[19] bringt Thomas Bauer die Gefahren einer derzeitigen Tendenz, die Welt immer weiter zu vereinfachen auf den Punkt, warnt vor dem Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt. Literarisches Übersetzen jedoch ist ein ausgezeichnetes Training genau jener Ambiguitätstoleranz, die er bedroht sieht und ohne die unsere modernen Demokratien in akuter Gefahr sind. Die Welt ist derzeit mit vielen Krisen konfrontiert, und nur durch globale Kooperation wird es möglich sein, diese noch zu meistern. Die Sprache der Krisenkommunikation aber ist – die Übersetzung.
Literaturübersetzen mit Kindern und Jugendlichen bedeutet, jungen Menschen eine Erfahrung zu ermöglichen, die Klaus Reichert in Anlehnung an Johann Georg Hamann so beschrieb: „Alles Reden ist Übersetzung – alles Wahrnehmen und Empfinden ist es auch. Mit dem Übersetzen beginnt die Welt“.[20]
[1] PISA wird die erste OECD-Erhebung zu den Lernergebnissen von Schülerinnen und Schülern (PISA) im Jahr 2000 genannt. Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in Deutschland lagen im Vergleich zu 31 anderen Ländern in den Bereichen Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften unter dem OECD-Schnitt.
[2] Markus Söder in einer Pressekonferenz am 27. 10. 2020 zum Thema „Schulschließung während Corona“.
[3] https://www.youtube.com/watch?v=Jo-dWriiDAY (Abruf vom 5. Februar 2022).
[4] Tweet von @nainablabla vom 19. Januar 2015: „Klar wir lernen in der Schule wichtige Sachen. Aber niemand bringt uns bei, wie man später auf eigenen Beinen steht. Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann ne Gedichtsanalyse schreiben. In 4 Sprachen.“
[5] Unterberg, Swantje, 2020, 4. August: Eltern wehren sich gegen Strafarbeit für Drittklässlerin. Der Spiegel. https://www.spiegel.de/panorama/bildung/deutschpflicht-an-grundschule-eltern-wehren-sich-gegen-strafarbeit-fuer-drittklaesslerin-a-c235f4e0-e8f4-47a3-b890-b13b3275e23e (Abruf vom 10.02.2022).
[6] „Drei Sprachen sind fürs Abitur genug!“ Ein Reformvorschlag für den Abbau von Diskriminierung von mehrsprachig Aufgewachsenen bei Schulabschlüssen, Redaktion Norbert Cyrus und Linda Supik, Hrsg: Rat für Migration, 2021.
[7] Rosemary Tracy: Mehrsprachigkeit. Vom Störfall zum Glücksfall, in M. Krifka, R. Tracy ua. (Hg) „Das mehrsprachige Klassenzimmer. Über die Muttersprachen unserer Schüler“, Heidelberg 2014.
[8] Der Sprachunterricht muss umkehren! Ein Beitrag zur Überbürdungsfrage von Quousque Tandem (Wilhelm Viëtor. 3., durch Anm. erw. Aufl. Leipzig: Reisland, 1905, in: „Die Neueren Sprachen“, 81 (1982) 2, S. 120-148.
[9] Antoine Vitez: Le devoir du traduire. In: Théâtre/Public 44 (1982), S. 9. Zitat nach Patrice Pavis: Semiotik der Theaterrezeption. Tübingen: Narr 1988, S. 118.
[10]Anders, Florentine, 2019, 3. Dezember: Die zehn wichtigsten Ergebnisse der PISA-Studie. Deutsches Schulportal. https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/die-zehn-wichtigsten-ergebnisse-der-pisa-studie/ (Abruf vom 21.07.2023)
[11] Vgl. dazu: Precht, Richard David: Anna, die Schule und der liebe Gott: Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern, München 2014.
[12]Sendung im Deutschlandfunk Nova, 2021, 6. November: „Gestikulieren hilft beim Vokabeln merken“, https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/fremdsprachen-lernen-gestikulieren-hilft-beim-merken (Abruf vom 12.02.2022)
[13] „Wie Schule endlich besser wird“, 2017, 8. Oktober, Der Spiegel. https://www.spiegel.de/spiegel/zehn-vorschlaege-wie-deutschlands-schulen-besser-werden-a-1169491.html (Abruf vom 20.02.2022).
[14] Im engeren Sinne gibt es zwar keinen einheitlichen, an deutschen Schulen vorgeschriebenen Kanon für die Schullektüre, gleichwohl wurde der Ruf nach einem solchem im Rahmen der Bemühung zur Vereinheitlichung von Lehrplänen lauter. Vorgaben, Empfehlungslisten, Zentralabitur u.a. führen in der Praxis aber dazu, dass bestimmte Autoren und konkrete Titel auf keiner dieser Listen fehlen (Goethe, Kafka, Lessing…) und auch die Titel nur minimal variieren. Daher habe ich mich hier entschlossen, von einem „Kanon“ zu sprechen, auch im Hinblick auf die Wirkung, mit der insbesondere die Klassiker den Schüler:innen als maßgebliche Literatur präsentiert werden.
[15] Steinkopf, Leander, 2022, 15. Juli: Mehr Begeisterung, bitte! Literatur im Schulunterricht. Taz. https://taz.de/Literatur-im-Schulunterricht/!5862460/ (Abruf vom 15.07.2022)
[16] Ebd.
[17] Wernli, Martina: Diverses lehren und lernen – ein Bericht aus einem Seminar. https://breiterkanon.hypotheses.org/485 (Abruf vom 01.03.2022).
[18] Kuick, Katharina & Karlsson, Ylva: Schreib! Schreib! Schreib! Die kreative Textwerkstatt, aus dem Schwedischen von Gesa Kunter, Weinheim 2016. Die Übersetzung wurde ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis (Sonderpreis „Neue Talente“).
[19] Bauer, Thomas: Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt. Stuttgart 2018.
[20] Reichert, Klaus: Die unendliche Aufgabe. Zum Übersetzen. München, Wien 2003, S. 9.
Miriam Denger hat Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen studiert, als Dramaturgin und Theaterpädagogin an verschiedenen Stadt- und Staatstheatern gearbeitet und ist seit ca. 5 Jahren freie Übersetzerin für spanischsprachige Theatertexte.